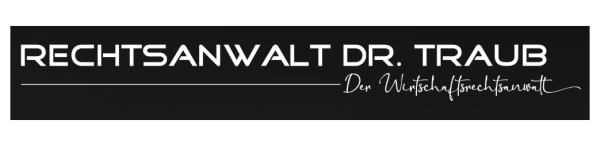Im Rahmen der Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) haben sich für die gängigen Gesellschaftsformen – die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die offene Handelsgesellschaft (OHG) und die Kommanditgesellschaft (KG) – einige wesentliche Unterschiede ergeben. Dieser Ratgeberartikel richtet sich speziell an interessierte Unternehmer und Gesellschaftsgründer und soll eine prägnante Übersicht über die wesentlichen Merkmale, Vor- und Nachteile der jeweiligen Rechtsformen der Personengesellschaften bieten.
Anhand konkreter Beispiele wird veranschaulicht, wie sich die unterschiedlichen Strukturen in der Praxis auswirken und welche Fragestellungen sich bei der Gründung oder Umstrukturierung einer Gesellschaft ergeben können.
Selbstverständlich sind die nachfolgenden Ausführungen nur ein Anriss hinsichtlich der jeweiligen Gesellschaftsform.
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Zweck
Die GbR ist eine auf Vertrag beruhende Vereinigung von Personen zur Förderung eines gemeinsamen Zwecks.
Dabei muss es sich nicht zwingend um ein Handelsgewerbe handeln, sondern auch um andere gemeinsame Interessen wie etwa die Verwaltung gemeinsamer Immobilien (häufiger Praxisfall (!)) oder die Durchführung eines gemeinschaftlichen Projekts.
Beispiel: Mehrere Freiberufler gründen eine GbR, um gemeinsam an einem Beratungsprojekt zu arbeiten und ihre Kompetenzen zu bündeln.
Haftung
Die Gesellschafter haften grundsätzlich unbeschränkt und mit ihrem gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Dies bedeutet, dass im Falle von finanziellen Schwierigkeiten auch das private Vermögen der Gesellschafter in Anspruch genommen werden kann, wenn das Gesellschaftsvermögen nicht ausreicht.
Beispiel: Bei einer GbR, die in einen Rechtsstreit verwickelt ist, können die Gläubiger direkt auf das Haus oder das Sparguthaben eines Gesellschafters zugreifen, um offene Forderungen zu begleichen.
Vorteile
Hohe Flexibilität und Zweckoffenheit
Die GbR bietet den Vorteil, dass sie sehr flexibel gestaltet werden kann, da es keine strengen gesetzlichen Vorgaben für den Unternehmenszweck gibt.
Dies erlaubt es den Gesellschaftern, den Vertrag individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen und auch den Zweck im Laufe der Zeit zu erweitern oder zu ändern.
Beispiel: Eine GbR, die ursprünglich für die gemeinsame Durchführung von Seminaren gegründet wurde, kann später problemlos ihre Geschäftstätigkeit auf den Verkauf von Weiterbildungsmaterialien ausweiten.
Weitgehend dispositive gesetzliche Ausgestaltung
Das Gesetz lässt den Gesellschaftern weitgehend Freiheiten bei der vertraglichen Gestaltung der Zusammenarbeit.
Hierdurch können individuelle Regelungen getroffen werden, die exakt auf die Bedürfnisse der Beteiligten zugeschnitten sind, ohne sich strikt an starre gesetzliche Vorgaben halten zu müssen.
Beispiel: Bei der Gründung einer GbR können die Partner eigenständig entscheiden, wie Gewinne verteilt und Verluste getragen werden, anstatt sich an die gesetzlichen Standardregelungen zu halten.
Geringe Gründungskosten und einfache Gründung
Die Gründung einer GbR ist relativ unkompliziert und mit geringen Kosten verbunden, da kein aufwändiges Gründungsverfahren notwendig ist.
Es bedarf keiner notariellen Beurkundung oder umfangreicher Formalitäten, was den Gründungsprozess beschleunigt.
Beispiel: Zwei Unternehmer können durch einen einfachen formlosen Vertrag schnell und kostengünstig eine GbR gründen, ohne hohe notarielle Gebühren befürchten zu müssen.
Nachteile
Unbeschränkte Haftung der Gesellschafter
Die persönliche und unbeschränkte Haftung stellt ein erhebliches Risiko dar, da im Falle von Verlusten das gesamte Privatvermögen zur Deckung der Verbindlichkeiten herangezogen werden kann.
Dies kann zu erheblichen finanziellen Belastungen führen, wenn beispielsweise unerwartete Forderungen oder Schadensersatzansprüche eintreten.
Beispiel: Sollte ein Auftrag schiefgehen und ein hoher Schadenersatz gefordert werden, haften die Gesellschafter einer GbR auch mit ihren privaten Rücklagen, was zu einer erheblichen finanziellen Belastung führen kann.
Keine Möglichkeit zur Haftungsbeschränkung wie bei der KG
Im Gegensatz zur Kommanditgesellschaft gibt es bei der GbR keine Option, die Haftung einzelner Gesellschafter zu beschränken.
Dies limitiert die Möglichkeit, das persönliche Risiko einzelner Gesellschafter zu minimieren und kann insbesondere für solche Personen, die nur beratend tätig sein wollen, nachteilig sein.
Beispiel: Ein Gesellschafter, der sich hauptsächlich als stiller Beteiligter engagieren möchte, muss in einer GbR dennoch mit seinem gesamten Vermögen haften, während er in einer KG als Kommanditist lediglich mit seiner Einlage haftet.
Offene Handelsgesellschaft (OHG)
Zweck
Die OHG ist auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinsamer Firma gerichtet.
Dies bedeutet, dass die OHG primär für den Handel und den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb konzipiert ist, wobei sie oft in der Industrie oder im Handel tätig ist.
Beispiel: Mehrere Unternehmer gründen eine OHG, um gemeinsam ein Einzelhandelsunternehmen zu betreiben, das sowohl Waren importiert als auch vertreibt.
Haftung
Die Gesellschafter haften unbeschränkt und mit ihrem gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Dies stellt ein hohes Risiko dar, da Gläubiger im Fall von finanziellen Schwierigkeiten direkt auf das persönliche Vermögen der Gesellschafter zugreifen können.
Beispiel: Wird eine OHG in eine Insolvenz geführt, können Bankkredite und offene Lieferantenrechnungen dazu führen, dass die privaten Ersparnisse der Gesellschafter herangezogen werden müssen, um die Schulden zu begleichen.
Vorteile
Geeignet für den Betrieb eines Handelsgewerbes
Die OHG ist prädestiniert für den aktiven Handel, da sie eine klare Struktur für den gemeinsamen Betrieb eines Handelsgeschäfts bietet.
Dies ermöglicht es den Gesellschaftern, sich auf ihre Kernkompetenzen im Handelsbereich zu konzentrieren und Synergien zu nutzen.
Beispiel: Eine OHG, die sich auf den Import und Vertrieb von Elektronikartikeln spezialisiert hat, kann durch die Bündelung von Ressourcen und Know-how eine stärkere Marktposition erreichen.
Flexibilität in der Gestaltung des Gesellschaftsvertrags
Auch in der OHG besteht die Möglichkeit, den Gesellschaftsvertrag individuell zu gestalten, sodass interne Abläufe, Gewinnverteilung und Entscheidungsbefugnisse den Bedürfnissen der Gesellschafter angepasst werden können.
Durch diese Freiheit können Konflikte vermieden und die Zusammenarbeit effizienter gestaltet werden.
Beispiel: Die Gesellschafter einer OHG können vereinbaren, dass strategische Entscheidungen einstimmig getroffen werden, während Routineentscheidungen durch einen Mehrheitsbeschluss erfolgen, um schnelle Reaktionen am Markt zu ermöglichen.
Nachteile
Unbeschränkte Haftung der Gesellschafter
Die unbeschränkte Haftung stellt auch in der OHG ein wesentliches Risiko dar, da im Falle von Fehlentscheidungen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten das Privatvermögen der Gesellschafter in Mitleidenschaft gezogen wird.
Dieses Risiko kann insbesondere in einem wettbewerbsintensiven Handelsumfeld zu erheblichen persönlichen finanziellen Belastungen führen.
Beispiel: Bei einem unerwarteten Markteinbruch oder einem Rechtsstreit aufgrund von Vertragsverletzungen können die Gesellschafter einer OHG persönlich für die entstandenen Schäden aufkommen müssen.
Verpflichtung zur doppelten Buchführung nach dem HGB
Die OHG unterliegt der Pflicht zur doppelten Buchführung, was nicht nur zusätzlichen administrativen Aufwand, sondern auch höhere laufende Kosten verursacht.
Diese Anforderungen können insbesondere für kleinere Unternehmen zu einer zusätzlichen Belastung werden, da sie spezialisierte Fachkenntnisse und entsprechende Software erfordern.
Beispiel: Ein mittelständisches Handelsunternehmen, das als OHG geführt wird, muss in regelmäßigen Abständen externe Buchhaltungsdienstleister beauftragen, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, was die Betriebskosten erhöht.
Kommanditgesellschaft (KG)
Zweck
Die KG ist ebenfalls auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinsamer Firma gerichtet.
Im Gegensatz zur OHG ermöglicht die KG durch die Kombination von unbeschränkt haftenden und beschränkt haftenden Gesellschaftern eine flexiblere Gestaltung der Beteiligungsverhältnisse.
Beispiel: Unternehmer gründen eine KG, um ein Produktionsunternehmen zu betreiben, wobei erfahrene Fachleute als Komplementäre die operative Führung übernehmen und Kapitalgeber als Kommanditisten lediglich finanziell beteiligt sind.
Haftung
Die KG hat mindestens einen unbeschränkt haftenden Gesellschafter (Komplementär) und einen oder mehrere beschränkt haftende Gesellschafter (Kommanditisten).
Dies ermöglicht es, das Haftungsrisiko der Kapitalgeber zu begrenzen, während die operative Verantwortung weiterhin von den Komplementären getragen wird.
Beispiel: In einer KG für ein Bauunternehmen haften die Kommanditisten nur mit ihrer Einlage, während die Komplementäre für sämtliche Verbindlichkeiten des Unternehmens voll einstehen, was die Investitionsbereitschaft externer Kapitalgeber fördert.
Vorteile
Möglichkeit zur Haftungsbeschränkung für die Kommanditisten
Durch die klare Trennung in Komplementäre und Kommanditisten können Investoren beteiligt werden, ohne ihr persönliches Vermögen über die Einlage hinaus zu gefährden.
Diese Struktur erleichtert zudem die Aufnahme von Fremdkapital und die Erweiterung der Gesellschafterzahl.
Beispiel: Ein Unternehmen, das in einer KG organisiert ist, kann externe Investoren gewinnen, die sich als Kommanditisten beteiligen, und so das Risiko für diese Investoren deutlich senken.
Flexibilität in der gesellschaftsrechtlichen Gestaltung
Die KG bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, um interne Strukturen und Entscheidungsprozesse individuell zu regeln.
Dies umfasst etwa Regelungen zur Gewinnverteilung oder zu den Befugnissen der Geschäftsführung, was zu einer passgenauen Ausrichtung an die unternehmerischen Bedürfnisse führt.
Beispiel: In einer KG können die Gesellschafter vereinbaren, dass bestimmte strategische Entscheidungen ausschließlich von den Komplementären getroffen werden, während operative Entscheidungen auch von den Kommanditisten mitbestimmt werden können.
Geeignet für die Unternehmensnachfolge
Die KG bietet aufgrund ihrer flexiblen Regelungen Möglichkeiten zur reibungslosen Übergabe von Unternehmensanteilen, was sie besonders interessant für Nachfolgeplanungen macht.
Dadurch können Familienunternehmen oder auch Unternehmer, die ihr Unternehmen langfristig sichern möchten, strukturiert auf die nächste Generation vorbereitet werden.
Beispiel: Ein Unternehmer kann seine Anteile als Kommanditist an seine Kinder übertragen, während er als Komplementär weiterhin die operative Führung behält, was den Übergangsprozess vereinfacht und gleichzeitig eine gewisse Kontrolle sichert.
Nachteile
Kompliziertere gesellschaftsrechtliche Situation durch die Kombination von zwei unterschiedlichen Rechtsformen
Die Dualität aus unbeschränkt haftenden Komplementären und beschränkt haftenden Kommanditisten führt oft zu komplexeren internen Regelungen und erfordert ein hohes Maß an Abstimmung.
Dies kann in der Praxis zu Konflikten oder zu einer unklaren Rollenverteilung führen, wenn die Zuständigkeiten nicht klar geregelt sind.
Beispiel: Bei unklar definierten Aufgabenbereichen innerhalb einer KG kann es zu Streitigkeiten zwischen den Komplementären und den Kommanditisten kommen, was im schlimmsten Fall die operative Effizienz beeinträchtigt.
Verpflichtung zur doppelten Buchführung nach dem HGB
Ähnlich wie bei der OHG unterliegt auch die KG der doppelten Buchführung, was zu einem erhöhten administrativen Aufwand und zusätzlichen Kosten führt.
Diese Anforderungen machen die Führung der Buchhaltung komplexer und können insbesondere für kleinere Unternehmen eine erhebliche Belastung darstellen.
Beispiel: Ein kleineres Handelsunternehmen in der Form einer KG muss möglicherweise externe Buchhalter oder spezialisierte Softwarelösungen einsetzen, um die strengen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, was zu zusätzlichen Fixkosten führt.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl der passenden Gesellschaftsform maßgeblich von den individuellen Bedürfnissen und Risikobereitschaften der beteiligten Unternehmer abhängt. Während die GbR durch ihre einfache Gründung und Flexibilität punktet, bieten OHG und KG durch die gezielte Aufteilung der Haftung sowie die Möglichkeit einer differenzierten Gestaltung im Gesellschaftsvertrag jeweils eigene Vorteile – jedoch auch zusätzliche Herausforderungen, wie beispielsweise die Verpflichtung zur doppelten Buchführung. Für Unternehmensgründer und potentielle Gesellschafter und Geschäftsführer ist es daher unerlässlich, sich umfassend über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Rechtsform für ihr konkretes Geschäftsmodell beraten zu lassen und für sich individuelle, auf den konkreten Fall zugeschnittene Lösungen zu entwickeln.
Gerne stehe ich Ihnen als Rechtsanwalt und Fachanwalt für eine rechtliche Beurteilung und Einschätzung Ihres Falles zur Verfügung und vertrete durchsetzungsstark und resolut auch Ihre Interessen ggü. Geschäftsführern, Lieferanten, Gesellschaftern, Behörden und Gerichten. Kontaktieren Sie mich gerne telefonisch oder schreiben Sie mich an.
Ich berate bundesweit vor Ort oder via Zoom als Rechtsanwalt und Fachanwalt in den Städten und Großräumen um Stuttgart, Heilbronn, Karlsruhe, Freiburg, Ulm, Augsburg, München, Frankfurt, Wiesbaden, Saarbrücken, Kaiserslautern, Bonn, Wuppertal, Duisburg, Nürnberg, Münster, Saarbrücken, Düsseldorf, Köln, Dortmund, Hannover, Kassel, Leipzig, Dresden, Bremen, Hamburg und Berlin.
Dieser Artikel stellt keine konkrete und individuelle Rechtsberatung dar, sondern gibt lediglich einen groben Erstüberblick über die geschilderte und sehr komplexe rechtliche Materie. Rechtliche Sicherheit für Ihre konkrete Fallkonstellation können Sie nur durch abgestimmte Prüfung und Beratung eines fachkundigen Rechtsanwalts erhalten.
#Gesellschaftsrecht #MoPeG #GbR #OHG #KG #Rechtsanwalt #Unternehmensrecht #Handelsrecht #Personengesellschaft #Haftung #Gründung #Vertragsrecht #BürgerlichesRecht #Geschäftsführung #Haftungsbeschränkung #Rechtstipps #Mandantenberatung #Wirtschaftsrecht #Unternehmensgründung #Rechtsberatung #Gesellschafter #Kapital #Nachfolge #Compliance #Buchführung #Handelsgewerbe #Firmenrecht #Strukturreform #Flexibilität #Gesellschaftsvertrag #Geschäftsmodelle #Risikomanagement #Unternehmer #Rechtssicherheit #Finanzrecht #Steuerrecht #Vertragsgestaltung #Wirtschaft #Business #Firmengründung #Rechtsformwahl #Kapitalbeteiligung #Gesellschaftsstruktur #Anwaltstipps #Wirtschaftsanwalt #Rechtspraxis #Gesellschaftervertrag #Haftungsrisiko #KaufmännischeBuchführung #Handelsregister #Fachanwalt #Gesellschaftsform